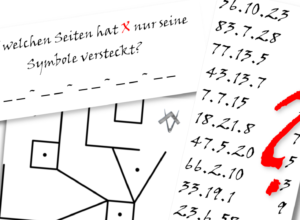Am 15. Juli war es endlich soweit. Noch während die Vorproduktion in vollem Gange war, lief die Kamera das erste Mal planmäßig los. Jener Samstag, der erste Drehtag, nahm nachmittags überraschend Fahrt auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: Wir entdeckten die Golfcarts für uns. Es war der Startschuss in eine spannende Zeit. Für die meisten war es der erste Filmdreh dieser Größe – und es sollte noch viel mehr geschehen.
Der Dreh. Die Produktion. Sonst kennt man dieses Magische, so ferne nur aus Behind the Scenes-Videos und Making-of-Dokus. Wahnsinnig kompliziert aussehende Technik und große Kameras. Regisseure, Kameraleute, Elektriker, Beleuchter, Assistenten. Auch hier Kaffeepraktikanten. Alle reden und rufen, völlig elliptisch, aber sie verstehen sich trotzdem. Und vor alledem die Schauspieler. Schrecklich eingeengt tauchen sie trotzdem ab in ihre Welt und lassen sich nicht beirren von all der Technik, die sie einkesselt. Es scheint wirklich ein magischer Ort zu sein.
Doch wenn man selber das erste mal am Set steht, bekommt man davon gar nichts mit. Man ist konzentriert auf seine Aufgabe, auf das, was man tun muss. Auf das, worauf sich die anderen verlassen. Keine Zeit für schweifende Gedanken. Und wenn sie‘s doch mal tun, dann kriegt man fast die Panik und versucht, schnell wieder zurückzukommen in den hektischen Trott am Set. Sonst hält man noch alles auf.
Zeit also, jetzt, wo alles vorbei ist, einmal zurückzutreten und den Dreh, dieses Spektakel, an dem man manchmal im Stress des Moments vorbeigerannt ist, von außen Revue passieren zu lassen. Zeit, sich selbst und auch euch einen Einblick zu geben, tief in das, was da vom 15. Juli bis zum 13. September Magisches passiert ist. Zeit, die Zeit am Set neu zu erleben.
Am Anfang ging es ganz gemächlich los. Der erste Dreh war für die Meisten neu. Wir wussten nicht so recht, was wir erwarten sollten. Klar hatten wir uns vorbereitet, aber wirklich gemacht hatten wir so etwas noch nie. Ich persönlich fühlte in meinem so eng sitzenden Regisseurskleid nicht wohl. Wenn es kreative Probleme gab, dann sollte ich entscheiden. Und es gab viele Probleme. Anfangs noch nicht so – für die erste Szene A10, in der Juliane durch den Wald joggt, gab es nicht so viele Möglichkeiten. Doch spätestens nachmittags, als Szene 5 dran war, ging die Post ab.
Plötzlich gab es von den Darstellern Vorschläge für neuen Dialog. War der besser? Was soll die Szene überhaupt sagen. Aber dann funktioniert das Bewegungsmuster nicht mehr. Welche Perspektive? Nein, da macht die Kamera einen Achsensprung. Aber…! Fällt er auf den Boden? Ne, blöd. Oder doch nicht? Was denn jetzt?
Es brauchte eine Ansage.
Das war ganz persönlich wohl mein größtes Problem. Eine klare Ansage zu machen. Eine Entscheidung zu treffen, mit der ich zufrieden war. Bei einem „könnte“ macht jeder was anderes. Doch ohne „muss“ kann jeder sein eigenes Süppchen kochen. Und plötzlich weiß niemand mehr, was Sache ist.
Eine Ansage machen also. Erst zur Hälfte des Films hatte ich das gelernt. Dann flutschte es meist besser. Davor ging der Dreh öfters nur langsam und schleppend voran. Ohne klares Ziel. Ohne Überzeugung, dass es gut wird. Erst mit der Ansage ist alles klar. Wo sind die Darsteller, was machen sie. Wo steht die Kamera, wo muss sie hin. Wohin den Fokus ziehen. Wo schlägt die Klappe. Wo kann die Tonangel hängen. „Angel im Bild!“ – Das gab‘s zu oft.
Nicht die Technik, sondern die kreative Entscheidung ist also das größte Problem am Set. Und es geht nicht nur uns so; auch die Profis wissen oft nicht, was sie genau wollen. Doch wie läuft das überhaupt ab, dieser Dreh, dieser Prozess am Set? Wie werden die Entscheidungen getroffen? Und sobald endlich alles klar ist – was passiert dann, bis es endlich losgeht?
Bereits einen Tag zuvor schickte ich an jeden, der an dem jeweiligen Drehtag beteiligt war, die Dispo. Jeder kann darauf die Zeit finden, zu der er am Set sein soll, und wo er sein soll. Hier ein Beispiel von Szene Nummer 46, bei der auch Prof. Meinel mitspielte:
- 9:30 – Kameramann, Script/Continuity/Klappe, Produktionsassistenz (Equipment & Requisiten aussuchen, in Hörsaalküche tragen und teils aufbauen)
- 10:00 – Sprechende Darsteller (Proben nur mit sprechenden Rollen, evtl. Kameraproben)
- 10:30 – Tonteam (restlicher Technikaufbau)
- 10:45 – Komparsen und weitere Produktionsassistenz (Ablauf- und Technikproben mit allen)
- 11:30 – Prof. Meinel (Drehs)
Nach und nach trudelten also die Leute ein. Meist erst ich und die Technik, um Kamera, Ton und Licht aufzubauen. Später kamen die Darsteller dazu, mit denen wir die Szene kreativ durchgingen, den Dialog manchmal anpassten und die Laufwege festlegten. Zum Schluss folgten Komparsen und weitere Helfer; und bei diesem speziellen Dreh ganz besonders noch Prof. Meinel. Als er kam, musste alles vorbereitet und eingeübt sein. Und dank der ganzen zwei Stunden Vorbereitungszeit ist uns das am Ende mit Bravour gelungen.
Doch nicht immer läuft alles glatt. Eigentlich läuft nie alles glatt. Während der zwei Stunden Vorbereitung auf Szene 46 lief auch nicht allzu viel glatt. Wir hatten viel zu wenige Paparazzi. Aber wir drehten während laufender Vorlesung – in der Pause hieß es also: Rumlaufen und Leute motivieren, sich als Komparse zu versuchen. Und die Fontänen im See waren an und hätten uns fast den Ton versaut. Dann haben die Akkus einiger der Kameras, welche die Paparazzi benutzten, nicht funktioniert. Und so weiter und so fort. Als noch die kreativen Probleme mit dazukamen, ist endgültig der Stress ausgebrochen am Set. Aber kein böser Stress – guter Stress. Wenn man das so sagen kann. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und man war auch ein bisschen stolz, dabei gewesen zu sein und die Herausforderung gemeinsam gemeistert zu haben.
Doch ich schweife ab. Was passiert denn jetzt konkret an so einem Set? Die Technik ist aufgebaut – worüber man übrigens zehn weitere Blogs schreiben könnte –, Laufwege sind festgelegt, eine Kameraeinstellung wurde gefunden – alle sind zufrieden. Dann geht’s los. Darüber müssen alle Bescheid wissen; bei unseren kleinen Teams ging das meist noch relativ einfach, doch an größeren Tagen wie dem Dreh von besagter Szene 46 blieben Einzelne immer wieder nicht auf dem Laufenden, weil sie eine Ansage verpassten oder jene Ansage einfach viel zu unklar war. Das konnte gefährlich werden – denn es bringt das ganze Set aus dem Fluss, wenn‘s bei jemanden hakt, der nicht genau weiß, was er jetzt gerade tun soll.
Sobald also allen klar ist, dass jetzt gedreht wird, gehen die Komparsen in Position. Ton und Kamera folgen. Schon jetzt stellt sich die Klappe – also derjenige, der die Synchronklappe schlägt – vor die Linse und hält die die Klappe mitten ins Bild. „Ton!,“ ruft einer, manchmal der Kameramann, manchmal die Klappe, manchmal ich. Vom Ton kommt ein „Läuft!,“ zurück. „Kamera läuft!,“ dann manchmal noch „Klappe!,“ ruft die Kamera. Das ist das Zeichen für die Klappe. „Szene 46 A, Take 3.“ Und dann ein lautes Klack! Die beiden Stäbe sind zusammengeschlagen. Die Klappe geht so schnell wie möglich aus dem Bild, und dann kommt von mir: „Und, bitte!“
Nach dem Spiel ein „Super, Danke, aus!,“ und alles hält wieder an. Der Take ist im Kasten.
„Das ist ja fast wie beim Militär,“ denkt sich der ein oder andere vielleicht. Aber dieser strenge Ablauf war nicht mal einstudiert; nach den ersten Takes am ersten Drehtag entwickelte er sich praktisch von selbst. So weiß im Druck des Takes immer jeder darüber Bescheid, was er zu tun hat – und niemand verschwendet Zeit mit unnötig langem Herumgerede. „Kamera läuft!“ – mehr muss man nicht sagen, um allen klarzumachen, dass, ja, die Kamera nun mal läuft.
Diese Routine brachte auch eine angenehme Entspannung in die Hektik und Unvorhersehbarkeit der Drehs. Es war ungemein einfacher, all die Herausforderungen zu bewältigen, wenn der technische, der meist immergleiche Teil schnell von der Hand ging. Und das mit den Herausforderungen galt wirklich für jeden einzelnen Dreh. Von jedem einzelnen Tag könnte ich Geschichten erzählen. Wie vom Ersten, als wir die Golfcarts entdeckten und als Kamerabühne benutzten. Es entstanden tolle Kamerafahrten. Und wir hatten eines: Unglaublich viel Spaß.
Weitere Artikel der Reihe:
So entsteht der Erstialarm – Teil 1: Vom Brainstorming zum Drehbuch
So entsteht der Erstialarm – Teil 2: Vorproduktion könnt‘ so einfach sein, isses aber nicht